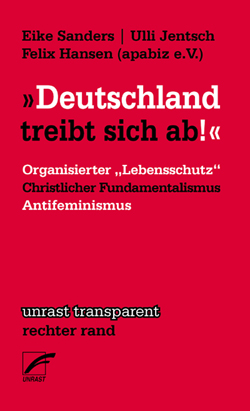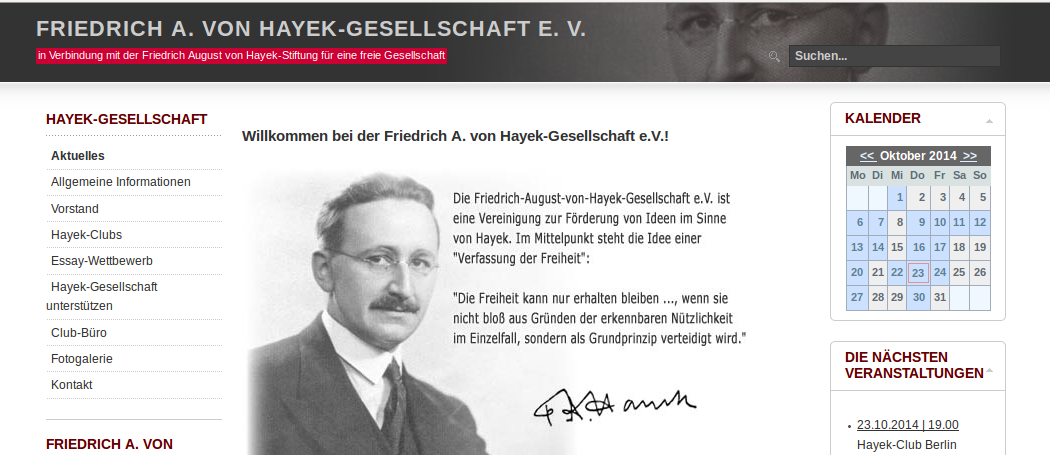Das erfolgversprechende Auftreten der AfD in der politischen Landschaft der Bundesrepublik Deutschland hat zu einer Debatte im jungkonservativen Lager geführt, in der gegensätzliche Positionen artikuliert wurden. Personelle Veränderungen hängen damit zusammen. Karlheinz Weißmann, die intellektuelle Führungsfigur im jungkonservativen Lager, ist aus der Redaktion der Sezession, der Zeitschrift des Instituts für Staatspolitik (IfS) ausgeschieden. Für das Juniheft hat er, zum ersten Mal nach rund elf Jahren, keinen Artikel verfasst. Auch auf dem Blog Sezession im Netz (SiN) wird er nicht mehr als Autor geführt. Die Junge Freiheit (JF), für die Weißmann regelmäßig schreibt, stellte ihn noch im April als wissenschaftlichen Leiter des IfS vor (JF 18/2014, 18), Anfang Juni wird auf diese Angabe verzichtet (JF 24/2014, 18). Damit scheint Weißmanns führende Rolle im IfS, das er zusammen mit Götz Kubitschek gegründet hat, beendet zu sein; solange es allerdings dazu keine offizielle Erklärung gibt, muss man dies noch mit einem Fragezeichen versehen. Möglicherweise wird es ein neues Arrangement auf veränderter Basis geben.
![(Bild: attenzione-photo.com)]()
(Bild: attenzione-photo.com)
Gastbeitrag von Helmut Kellershohn [Artikel (aktualisierte Fassung, Juni 2014) zuerst veröffentlicht vom Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung (DISS)]
Im Kern geht es um die Haltung zur AfD und um die Frage, ob und, wenn ja, in welchem Ausmaß die AfD unterstützt werden kann und soll. Theoretisch gesprochen: Es geht um das ‚rechte’ Verständnis von Real- und Metapolitik. Zur Debatte steht aber auch das Verhältnis zwischen IfS und der Jungen Freiheit, die sich für die AfD von Anfang an publizistisch engagiert hat. – Im Folgenden gehe ich zunächst auf dieses Verhältnis ein, um dann im Weiteren die kontroversen Positionen der jungkonservativen Protagonisten zur AfD in ihrer Entwicklung zu skizzieren. Abschließend folgt eine Bewertung der derzeitigen Konstellation.
Zur Vorgeschichte (1)
Das im Jahr 2000 gegründete Institut für Staatspolitik (IfS) bildete zusammen mit dem Verlag Antaios (Leiter: Götz Kubitschek) und der Berliner Wochenzeitung Junge Freiheit (JF) den Kern eines Netzwerks von arbeitsteilig operierenden Einrichtungen, die sich auf unterschiedliche Aufgabenfelder spezialisierten und gleichzeitig miteinander kooperierten. Die politische Hauptaufgabe der JF sah Chefredakteur Dieter Stein darin, langfristig mit publizistischen Mitteln an der Bildung eines tragfähigen gesellschaftlichen Milieus für die Durchsetzung rechter Positionen auf parlamentarischer Ebene mitzuwirken. Es sei „höchste Zeit für die Formierung eines starken konservativ-freiheitlichen Widerlagers“, das in der Lage sei, die staatstragenden Parteien, insbesondere aber „die Union von rechts unter Druck“ (JF 41/2009, 1) zu setzen und eine Ausdifferenzierung des Parteiensystems nach rechts hin zu bewirken.
Das IfS enthielt sich solch parteipolitischer Ambitionen, verstand sich selbst als „Kern einer konservativen Denkfabrik“ (Weißmann 2011, 74) in der Tradition der Konservativen Revolution. Es widmete sich den Bereichen von Forschung und Wissenschaft, Fortbildung und Politikberatung. „Uns geht es“, umschrieb Weißmann die metapolitische Stoßrichtung des Instituts (JF 36/2001, 6), „um geistigen Einfluß, nicht die intellektuelle Lufthoheit über Stammtischen, sondern über Hörsälen und Seminarräumen interessiert uns, es geht um Einfluß auf die Köpfe, und wenn die Köpfe auf den Schultern von Macht- und Mandatsträgern sitzen, um so besser.“ Das IfS sei eine „Kaderschmiede des Metapolitischen“, schrieb Moritz Schwarz (JF 17/2002); es gehe aber nicht nur um die „Bildung einer rein geistigen“ Elite, sondern langfristig um die einer „klassischen Elite“, die in der Lage sei, „Geistigkeit auch in Führungskompetenz umzusetzen“ und „Entscheidungspositionen in Kultur, Gesellschaft und Politik“ zu erringen und „somit mit den Eliten des linken und liberalen Spektrums“ gleichzuziehen.
Die unterschiedlichen strategischen Orientierungen führten zuweilen zu Irritationen. So gab es über einen längeren Zeitraum eine z.T. heftig geführte Debatte über den Begriff ‚Neue Rechte’, der von Seiten des IfS durchaus als Ehrentitel für die ‚Sezession’, die Loslösung vom hegemonialen Diskurs und von einem gewöhnlichen, mehr oder weniger sinnentleerten Konservatismus, verstanden wird. Dieter Stein bestritt Sinn und Nutzen dieses Begriffs und hielt ihn für rufschädigend, aus seiner Sicht angesichts der langjährigen Auseinandersetzung mit dem NRW-Verfassungsschutz durchaus verständlich. Stattdessen plädierte er, ganz im Sinne der vorhin skizzierten strategischen Orientierung, für die vorbehaltlose Besetzung des Begriffs ‚konservativ’, da für ihn „der politisch-publizistische Standort ‚konservativ’ in Deutschland durch keine etablierte Partei oder ein Medium vertreten“ sei.
In der Sache, nämlich in Bezug auf das Konservatismusverständnis, war diese Debatte wenig ergiebig. Beide Seiten stimmten in ihrem positiven Bezug auf die Konservative Revolution und die Strömung des Weimarer Jungkonservatismus überein. Die JF hat sich in ihrem „Leitbild“ ausdrücklich dazu bekannt. Allerdings spiegelt sich in diesen Irritationen das prekäre Verhältnis von Realpolitik und Metapolitik wider. Beide Formen des politischen Kampfes finden zwar ihre Einheit im identischen Ziel, unterscheiden sich aber in ihrem Blick auf die konkrete Lage, die es nach Maßgabe des Ziels zu verändern gilt. Realpolitik orientiert sich am Möglichen, trifft ihre Entscheidungen immer unter den gegebenen Bedingungen, berücksichtigt die gesellschaftlichen und politischen Kräfteverhältnisse, macht Kompromisse, geht taktische Umwege etc.; Metapolitik dagegen bewegt sich im Modus des Weltanschauungs- und Kulturkampfes und sucht in den konkreten politischen Auseinandersetzungen die „Absicherung im Prinzipiellen“ (Weißmann 2007, 87), die das Mögliche immer mit dem Stempel des Vorläufigen versieht. Insofern stehen Real- und Metapolitik in einem Spannungsverhältnis zueinander, das die Möglichkeit von Irritationen und Differenzen in sich birgt. Andererseits aber muss auch der Metapolitiker sagen können, welche politischen Entscheidungen und Entwicklungen in einer konkreten Situation er für (relativ) sinnvoller hält und welche nicht. Metapolitik ist, so Weißmann, keine „Ausflucht“ (ebd.), etwa in Form einer unverbindlichen Kulturkritik, sondern muss auch den Regeln der Politik als einer „Kunst des Möglichen“ Rechnung tragen.
Das Verhältnis zur AfD
Dieter Stein begründete in einem Beitrag für ein Sonderheft der Sezession („Alternativen für Deutschland“, Mai 2013) die publizistische Unterstützung für das AfD-Projekt damit, dass die AfD das „Thema der verantwortungslosen Euro-Rettung“ und damit verbunden „die endgültige Schleifung der nationalen Souveränität“ in das „Zentrum der Debatte“ gerückt habe; zudem betonte er, dass es bei aller gebotenen Skepsis gegenüber der weiteren Entwicklung der AfD „von übergeordnetem Interesse“, d.h. vorrangig sei, das „Monopol[ ] der CDU“ zu brechen (Stein 2013, 19). Als ‚Morgengabe’ einer gedeihlichen Zusammenarbeit verfasste Stein einen programmatischen Text „Für eine neue Nation“ (JF 41/2013, 18), der eigentlich auf die Auseinandersetzungen in der Deutschen Burschenschaft (DB) gemünzt war,(2) zweifellos aber auch die Bedürfnisse der AfD im Blick hatte, insofern er sich auf die seiner Meinung nach liberalen, freiheitlichen Traditionen der DB berief und für einen „erneuerten Volkstumsbegriff“ warb. Denn nach fünfzig Jahren Einwanderung habe „sich das Bild Deutschlands gewandelt“. Es sei daher „realitätsfremd“, „an einem engherzigen volkstumsbezogenen Vaterlandsbegriff festzuhalten, der integrationswillige Einwanderer und Kinder von solchen“ ausschließe. Steins Ausführungen knüpfen an das JF-offiziöse „Manifest für die Zukunft Deutschlands im 21. Jahrhundert“ (JF 42/2012, 3), das von dem Burschenschaftler Michael Paulwitz verfasst wurde (vgl. auch Paulwitz, in: JF 49/2012, 22). Mittlerweile hat Stein seinen Beitrag zum Ausgangspunkt eines Buches gemacht (vgl. Stein 2014).
Gegenüber soviel realpolitisch motivierter Flexibilität waren bereits vor Erscheinen dieses Artikels Stimmen aus dem IfS laut geworden, die die publizistische Unterstützungsarbeit der JF mit Skepsis und Kritik bedachten. Sie wiesen warnend auf eine womöglich zu starke Anpassungsbereitschaft der Partei an den hegemonialen Diskurs hin, die nicht mehr abgedeckt sei durch eine den Umständen angemessene Taktik der politischen „Mimikry“ (vgl. Lichtmesz 2013a). Die Unterstützung für die AfD könne dem möglicherweise Vorschub leisten (vgl. Lichtmesz 2013b). Konkrete Anlässe für diese Interventionen waren der „Fall Kuhlmann“ – der evangelikale, islamfeindliche Theologe, JF-Autor und IfS-Referent, war als Redner von einer AfD-Veranstaltung ausgeladen worden (siehe Neue Osnabrücker Zeitung v. 12.09.2013) –, der der JF nur eine Randnotiz wert war (JF 39/2013), und im verständnisvollen Ton gehaltene Äußerungen zum Aufnahmestopp für „Die Freiheit“-Mitglieder (Marcus Schmidt, JF 42/2013).
Im Oktober schließlich sagte die JF ihren Stand auf dem vom IfS veranstalteten Vernetzungstreffen, dem zum zweiten Mal stattfindenden Zwischentag, ab. Dieter Stein ließ seinen Mitarbeiter Henning Hoffgaard (JF 42/2013, 18) ‚mitteilen’, dass eine breitere politische Aufstellung der Messe erwünscht sei, vorausgesetzt, es komme „zu einer selbstkritischen Auseinandersetzung über ‚rechte’ Positionen“. Angespielt wurde damit zum einen auf den (angekündigten) Auftritt des „italienischen Publizisten und Vordenkers des neofaschistischen Projekts Casa Pound“, Gabriele Adinolfi, von dem Hoffgaard zu berichten wusste, dass ihm die Verwicklung in den Anschlag von Bologna (1980) angelastet werde. Zum anderen auf einen (nicht angekündigten) Redebeitrag des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der neonationalsozialistischen Partei Jobbik, Márton Gyöngyösi, der – so Hoffgaard – „in der Vergangenheit vor allem durch seine als antisemitisch kritisierte Reden auf sich aufmerksam gemacht“ habe. Und: „2012 hatte er gefordert, Juden, die für den ungarischen Staat arbeiten, registrieren zu lassen. Später hatte er sich für seine Äußerungen entschuldigt. Er habe damit nur ungarische Juden mit einer israelischen Staatsangehörigkeit gemeint.“
Die von der JF erhobene Forderung nach einer selbstkritischen Besinnung knüpfte zweifellos an ihre sorgsam gepflegten Abgrenzungsbemühungen von der NPD an, ebenso wie an ihre Kritik an der Zweckmäßigkeit des Begriffs „Neue Rechte“ (wobei letztere nie ein Grund war für die Aufkündigung der Zusammenarbeit mit dem IfS). Götz Kubitschek freilich nahm die Forderung (vor dem Hintergrund der vorhin beschriebenen Vorgeschichte) ziemlich grundsätzlich, beschwerte sich über die seiner Meinung nach einseitige und falsche Fixierung des JF-Artikels auf „die Enttarnung des fragwürdigen ausländischen Besuchs“ und rückte ihn im Rahmen eines Textvergleichs in die Nähe der Berichterstattung der Berliner Zeitung und der Jungle World (Sezession im Netz v. 06.10.2013). In der an seinen Beitrag anknüpfenden Diskussion auf SiN stellte er die polemische Frage: „wer ist partner, wer gegner, wer egal?“
Dieses Misstrauensvotum an die Adresse der JF speist sich aus einer Überlegung, die Kubitschek an früherer Stelle geäußert hat. Im Vorwort zu dem bereits erwähnten Mai-Sonderheft der Sezession (Kubitschek 2013, 1) entwickelt er folgende Problemsicht: zunächst gewinnt er dem AFD-Kurs der JF Positives ab, insofern es sich „bei der AfD um eine Ausweitung der Kampfzone und um die Öffnung eines zusätzlichen Resonanzraums“ handele. Zugleich aber, so die Warnung, sei dies „die Zementierung einer Mauer“, will sagen: „Wer jetzt nicht mit dabei ist, sondern von rechts kritisiert, ist gründlicher außen vor als bisher. Denn er ist selbst an diese Bewegung nicht mehr anschlußfähig. Insofern käme der AfD im System des Machterhalts und des Elitenwechsels der Mitte die Rolle des Staubsaugers und zugleich der Kantenschere zu.“
Götz Kubitschek: Der Einzelne, der politische Raum und das Ganze
Wovor Kubitschek warnte, ist zweifellos realpolitisch gedacht, drückt aber zugleich ein Dilemma aus, das durchaus selbstverursacht ist. Am deutlichsten wird das bei Kubitschek selbst und dessen Reflexionen über die Sphären des Einzelnen, des politischen Raums und des Ganzen (Kubitschek 2014, 33-35). Sein existentialistisches Politik-Verständnis mit der emphatischen Bezugnahme auf das „anmaßende Ich“ transportiert eine Beliebigkeit des Handelns, der es im Wesentlichen um die Selbstbehauptung im Kampf zu tun ist: der Einzelne als „Ein-Mann-Kaserne“. Das Handeln müsse dem Kriterium der „expressiven Loslösung“ genügen: „Denn dies gehört zum unverwechselbaren Stil der Ein-Mann-Kaserne, deren Tore aus Mangel an Versöhnung mit den gegenwärtigen Verhältnissen geschlossen wurden“ (Kubitschek 2012, 13; Hervorh. v. Vf.). Daran gemessen erscheint der gegebene Raum des Politischen bloß als eine Sphäre, die von „der Arbeit am Machbaren“, von „Ausgleich und Kompromiß“ geprägt ist (2014, 34). Hier regiert das „Angemessene“, nicht die „Anmaßung“ des Einzelnen, sein Schicksal selbst zu bestimmen. Der Politiker wird zum „anti-erhabenen Typ […] und kann keine Alternative mehr formulieren.“ (35) Was aber ist die große Alternative, wenn das „Ganze“, vulgo: das System, angesichts der „schleichende Katastrophe, dieser Auflösung aller Dinge“ in Frage steht? Kubitschek nimmt diesbezüglich Zuflucht zu Maßstäben, die aus anderen Feldern als dem der Politik herrühren, aus den Bereichen des Religiösen und Ästhetischen. Wer die Alternative wolle, brauche eine „Große Erzählung“, eine nationale Mythologie, „und vor allem wäre er von furchterregender, angemessen (!) rücksichtsloser Entschlossenheit. Der Einzelne und sein inneres, sein poetisches Reich – wer wirklich schöpferisch und restaurativ zugleich wirken will, muß dort gewohnt haben.“ Stauffenberg und das Geheime Deutschland lassen grüssen.
Kubitscheks Absage an eine realistische Sichtweise des Politischen führt ihn vor eine Grundsatzentscheidung. In einer Situation, in der viel „Konservative und Rechte“ die Möglichkeit sähen, vermittels der AfD „zu Wirkung, Einfluß, sogar zu Macht zu gelangen“, wirft er die Frage auf, ob es recht sei, die Regularien des politischen Raums zur „Richtschnur rechten Denkens, Publizierens und Handelns“ zu machen, Parteidisziplin zu üben und auf die „Anmaßung – diese Maximalforderung des Ichs oder des Ganzen“ zu verzichten? Und das zu Gunsten einer „ganz klein wenig aufbrechenden, durch und durch liberalen, abgesicherten, auf die Mitte hin orientierten Konservatismus?“ Und mit Blick auf das Projekt Sezession heißt es zugespitzt: „Dies ist also eine grundsätzliche Entscheidung: für oder gegen die Sezession“ (Hervorh. v. Vf.).
Kubitscheks Haltung zur AfD (und zur JF) nahm hier eine Wendung, die die Funktion und das Selbstverständnis der Zeitschrift berührte und damit der intern und zugleich öffentlich geführten Debatte im Umkreis des Instituts für Staatspolitik eine bewusste Schärfe verlieh. Der Adressat war vor allem: Karlheinz Weißmann.
Karlheinz Weißmann: Politik und Metapolitik
Die Frage, wie man sich im jungkonservativen Lager auf die AfD zu beziehen habe, hat Weißmann zu Präzisierungen ‚gezwungen’, die das Verhältnis von Real- und Metapolitik berühren.
Bereits im Augustheft 2013 hatte er gegen die Hype um die Identitären in Frankreich, deren Bewegung in der Sezession vor allem von Lichtmesz und Kubitschek positiv aufgegriffen wurde, die Notwendigkeit von politischen Organisationen und Parteibildungsprozessen betont, die willens und fähig seien, auf die „Mitte“ Einfluss zu nehmen. In diesem Zusammenhang ging er gezielt und wohlwollend auf die AfD ein: „Dieser Versuch, den gesunden Menschenverstand zu organisieren, setzt auf die Mobilisierung der […] Mitte, was angesichts der bestehenden Kräfteverhältnisse die einzig denkbare Option für ein anderes politisches Handeln ist“ (Weißmann 2013a, 13; Hervorh. v. Vf.). Die Rolle, die er dem IfS dabei beimaß, beschrieb er als eine weiterhin metapolitische und insbesondere konzeptionelle Arbeit, deren Ziel es letztendlich sein müsse, „einen ideologischen Gesamtentwurf zu schaffen“.
Auf dem 2. Zwischentag hielt Weißmann dann zum Thema „Politik und Metapolitik“ einen Vortrag, dem er im Dezemberheft 2013 der Sezession einen demselben Thema gewidmeten Artikel folgen ließ. Der Artikel führt das Verhältnis von situationsbezogener realpolitischer Option und langfristiger konzeptioneller Arbeit (im Übrigen unter Bezugnahme auf Gramsci) weiter aus (Weißmann 2013b, 41):
1. „Metapolitik ist […] nur sinnvoll als Teil von politischen Strategien.“ Sie „muß Lagen analysieren und Machbarkeitsfragen stellen“, sie „interessiert sich zwingend auch für politische Praxis und deren Träger“, was nicht bedeute, so Weißmann mit Blick auf Kubitschek, „seine persönlichen oder ästhetischen Maßstäbe gegenüber der Politik zur Geltung“ zu bringen, denn die seien „nicht politisch“.
2. Metapolitik kann nur dann Wirksamkeit entfalten, wenn sie anschlussfähig ist und „gehört“ wird. „Provokation und Konfrontation“, d.h. die von Kubitschek bevorzugten Optionen (vgl. Kubitschek 2007), seien daher „nur ausnahmsweise Mittel der Wahl“.
3. Metapolitik ist auf einen langen Zeitraum eingerichtet („gedehnte Fristen“, „langer Atem“) und erfordere ob vieler „Unwägbarkeiten […] Geduld, Klugheit und Geschick“, immer aber den Bezug auf den „Alltagsverstand“. Mit einer voluntaristischen und sektiererischen („Konventikel, in denen jeder die ‚Sprache Kanaans’ spricht“) Praxis sei das nicht vereinbar.
4. Es gibt keine „Erfolgsgarantie“ für Metapolitik, zumal der „Kulturkampf von rechts auch in Zukunft aus einer Position der Schwäche geführt“ werde, was „die Zielsetzung und die Wahl der Mittel bestimmen“ müsse.
Repliken
Diese Ausführungen Weißmanns blieben nicht unbeantwortet. Vor allem aus der jüngeren Autoren-Generation des IfS sprangen Martin Lichtmesz und Manfred Kleine-Hartlage im selben Heft der Sezession Kubitschek zur Seite.
Lichtmesz (2013c, 42-45), der sich als Sprachrohr der sog. Identitären Bewegung versteht, beschwor mit Blick auf die Zuwanderung das apokalyptische Bild, dass es bereits „fünf nach zwölf“ sei, und fragte als selbsternannter Anwalt der heute zwanzigjährigen ‚Einheimischen’: „Ist es da ein Wunder, dass sie kaum ein Ohr haben für jene, die ihnen zuviel von einer Metapolitik des ‚langen Atems’ und der ‚Vorbereitung’ reden, Strategien, deren Wirkung völlig unbewiesen ist, und die offensichtlich bis heute nicht aufgegangen sind?“ Und er verteidigte die von Weißmann als Ausnahmestrategien abqualifizierten Optionen „Provokation und Konfrontation“, wie sie auch von der Identitären Bewegung verfolgt werden: „Deren Erfolgsaussichten scheinen mir jedenfalls auch nicht weniger gewiß zu sein als die Hoffnung, dass die gut vorbereiteten Konservativen in der Stunde X aus ihrer Schattenexistenz geholt würden.“ Natürlich müsse man weiterhin Metapolitik betreiben und natürlich müsse man sich auf die „Widerstandspotentiale“ im „bürgerlich-liberalen Lager“ – darunter subsumiert er die AfD genauso wie die FPÖ und den Front National – beziehen. Aber, so seine skeptische Auskunft, man werde sehen, „ob all diese nicht lediglich dies waren: nützlich retardierende Werkzeuge auf dem Wege zur vollendeten Zersetzung.“
Kleine-Hartlage (2013b, 46-48), der von sich glaubt, dass er mal ein ‚Linker’ gewesen sei, sich nun aber auf dem ‚rechten’ Pfad der Tugend befände, opponiert gleich gegen die politische Geschäftsgrundlage des IfS, indem er dessen strategischen Bezug auf die Eliten, zu denen er auch die ehemals oppositionelle 68er-Linke rechnet, in Frage stellt: „Für eine rechte Opposition kommt […] eine Strategie von vornherein nicht in Betracht, die primär darauf abzielt, Positionen innerhalb der Eliten zu besetzen und von dort aus in die Gesellschaft hineinzuwirken.“ Stattdessen empfiehlt er eine „Einkreisungsstrategie“. Es gelte, „das Feld von unten nach oben und von außen nach innen aufzurollen, das heißt das herrschende Machtkartell von der Peripherie her unter Druck zu setzen“.
Dazu sei es erstens notwendig, so Kleine-Hartlage in einem früheren Aufsatz (2013a, 42-44), eine Einengung von Metapolitik auf konzeptionelle Arbeit zu vermeiden, sondern von „eine[r] Pluralität metapolitischer Kommunikationsformen“ auszugehen und an einer Vernetzung von „politisch und soziologisch heterogene[n]“ Milieus über eine gemeinsame Feindbestimmung (gegen die herrschenden Eliten) zu arbeiten. Diesbezüglich plädiert Kleine-Hartlage – nach dem Muster der Querfront-Strategie des jungkonservativen TAT-Kreises in der Endphase der Weimarer Republik – für ein „Bündnis mit der linken Peripherie“ (2013b, 47): Es gäbe „eine kleine, aber wachsende Fraktion der antiimperialistischen Linken, die gegenüber rechten Themen und Positionen kaum noch Berührungsängste“ habe, wie z.B. die Gruppe um Jürgen Elsässer und dessen Zeitschrift Compact (vgl. Kleine-Hartlage 2013a, 44). Zweitens betont er die Nachrangigkeit von Parteipolitik gegenüber Metapolitik: „Wer metapolitisch wirken will“, der dürfe „nicht darauf aus sein, schon zu Beginn den kleinsten gemeinsamen Nenner mit der ‚Mitte’ zu suchen“ (2013a, 44).
Karlheinz Weißmann: Umbau des Parteiensystems
Die Gegenreplik von Weißmann – die Europawahlen hatten soeben den Aufwärtstrend der AfD bestätigt – ließ nicht lange auf sich warten. Interessant ist nur, wo sie erschien. Jedenfalls nicht im Juniheft der Sezession (H. 60), das dem Thema „Demokratie“ gewidmet war und den Abonnenten im Begleitschreiben Kubitscheks süffisant als „eines der besten Sezession-Hefte, das wir je fertig stellten“, offeriert wurde, und das nach rund elf Jahren zum ersten Mal ohne einen Text von Weißmann. – Nein, die Gegenreplik erschien auf der Forums-Seite der JF mit dem hintersinnigen Titel „Die Geduld hat ein Ende“ (JF 24/14, 18), womit Weißmann auf den bereits zitierten Artikel in der Sezession anspielte, in dem er die Geduld des Metapolitikers beschworen hatte. Dass die Geduld nunmehr ein Ende habe, signalisierte freilich nicht den Abschied vom „langen Atem“, sondern zielte auf den politischen Möglichkeitsraum, der sich mit der Etablierung der AfD, getragen von einer Aufkündigung „schafsmäßige[r] Geduld“ von Seiten ihrer Wähler, eröffnen könnte.
Weißmann skizziert also ein Szenario für die weitere Entwicklung der AfD und ordnet es dem langfristigen strategischen Kalkül der Jungkonservativen zu. Es geht perspektivisch um den „Umbau des Parteiensystem“ als einem Teilziel des von den Jungkonservativen angestrebten Umbaus des Staates. Damit knüpft er an einen Artikel Dieter Steins vor den Europawahlen an (JF 22/2014, 1), in dem dieser eine „historische Umwälzung des deutschen Parteiensystems“ prognostiziert hatte.
Weißmann holt zunächst weit aus und beginnt mit einem Rückblick auf die Parteiengeschichte, besonders im Kaiserreich. Auf die Ausbildung von Massen- und Weltanschauungsparteien auf der Linken und im Lager des politischen Katholizismus hätten Liberale und Konservative aufgrund ihrer Organisation in Honoratiorenvereinigungen keine angemessene Antwort gehabt. Dazu hätte es der Weiterentwicklung zur Volkspartei bedurft, was dann unter den veränderten historischen Bedingungen der Nachkriegszeit von den Unionsparteien nachvollzogen worden sei. Auf europäischer Ebene erwähnt Weißmann als Beispiele für die von ihm als notwendig erachtete „Anverwandlung“ an den Gegner die Tories oder die Gaullisten in Frankreich.
Es folgt der Blick in die Gegenwart: Ob sich die rechtspopulistischen Parteien zu Volksparteien weiterentwickeln könnten, stünde noch nicht fest. „Protestler“ wie die Freiheitspartei in den Niederlanden drohten an dieser Hürde zu scheitern, die „Nationalen“ wie der Front National oder die FPÖ verfügten über eine „stabile Basis“ und ein „erprobtes Rezept“ (3) für einen weiteren Ausbau. Zu einer dritten Gruppe, den „Unbeugsamen“, zählt Weißmann die UKIP und – trotz der Abgrenzungsbemühungen Luckes – die AfD, die beide sich durch eine „strukturelle Ähnlichkeit“ auszeichneten:
In beiden Fällen sei die „Führungsriege“ seriös; Personal und Anhängerschaft kämen zum großen Teil „aus den Reihen der eigentlich dominierenden bürgerlichen Parteien“; aber auch Menschen ohne politische Heimat oder aus dem Umfeld von Außenseiterparteien würden erreicht. In beiden Fällen sei man „beunruhigt“ über den Verrat nationaler Interessen durch die politische Klasse zu Gunsten „einer gesichtslosen Bürokratie“, des „global operierenden Kapital[s]“ oder „der vaterlandslosen Intelligenz“; beide Parteien repräsentierten vor allem die Mittelschicht, d.h. solche Leute, die „hart“ arbeiteten, Steuern zahlten, Familien gründeten und Kinder großzögen.
Der Erfolg der AfD, so Weißmann weiter, sei einerseits der „klugen Taktik“ ihrer Führungsgruppe geschuldet, „möglichst wenig Angriffsflächen zu bieten […] und immer die ‚Normalität’ der Partei“ zu betonen; andererseits sei die Zeit, angesichts der „Veränderung des gesellschaftlichen Klimas“, einfach reif gewesen für eine Partei wie die AfD. Zeit also auch, um über wünschens- bzw. nicht-wünschenswerte Perspektiven nachzudenken.
Nicht-wünschenswert sei es, wenn durch die Etablierung der AfD das „bürgerliche Lager“ insgesamt, nämlich infolge der Spaltung und aufgrund fehlender Kooperationsbereitschaft, geschwächt würde; es würde dann eine „ähnliche Situation wie für die Grün-Rot-Tiefroten auf der Gegenseite entstehen“. Im Umkehrschluss hält also Weißmann, ohne das offen auszusprechen, eine Koalition der Unionsparteien mit der AfD als naheliegendste Perspektive für wünschenswert (was den Planspielen mancher Konservativer in der Union entgegenkäme). Er geht aber noch einen Schritt weiter:
„Die AfD ist aber noch nicht am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen, und wenn sie zur Sammlung all derjenigen wird, die die Tassen im Schrank behalten, ergeben sich ganz neue Perspektiven. Dann geht es nicht mehr um Juniorpartnerschaften, dann geht es tatsächlich um eine Neugestaltung des deutschen Parteiensystems.“
Will sagen: Wünschenswert wäre es, wenn die AfD sich realiter in Richtung einer Volkspartei entwickeln würde, was Lucke ja bereits anlässlich der Ergebnisse der Europawahlen als gegeben konstatiert hatte. Diese „Anverwandlung“ an den Gegner, von der Weißmann eingangs gesprochen hatte, würde die Kräfteverhältnisse im bürgerlichen Lager ändern, und die Koalitionsfrage könnte aus einer Position der Stärke neu verhandelt werden, etwa nach dem Modell der grün-roten Koalition in Baden-Württemberg. Das ist sicherlich Zukunftsmusik und wird es womöglich auch bleiben. Weißmann ist sich darüber im Klaren, dass eine solche Entwicklung von „schwer kalkulierbar[en]“ Faktoren abhängt. Die AfD müsste weiter an „Anziehungskraft“ gewinnen und die Krisenlage sich weiter verschärfen. Die Frage sei, „ob es das Personal der Altparteien weiter schafft, die Krisensymptome zu kaschieren, oder ob der Prozeß eskaliert und die Einschätzung Luckes zutrifft, daß die Probleme viel größer und viel schwerwiegender sind, als bisher zugegeben“.
Die Bedeutung der ‚große Krise’ für einen Wandel der Machtverhältnisse hat Weißmann in den letzten Jahren immer wieder betont. „Die Konjunktur der Rechten“ hänge ab von der „Wahrnehmung innerer oder äußerer Bedrohung“, schrieb er 1996 in der Jungen Freiheit (JF 44/1996, zit. nach Weißmann 2000, 250). 2007 prognostizierte er „eine dramatische Zuspitzung der Krise“ für die „nächsten zehn Jahre“, die „Unfähigkeit“ der Politischen Klasse werde überdeutlich werden (Weißmann 2006, 80). Nur in einer solchen Situation sei ein Elitenwechsel möglich (Weißmann 2009b, 14). Und nur dann sei es möglich, die Verfassung aus „der Gefangenschaft der Linken und Liberalen zu befreien“ (ebd., 15).
Fazit
Die Gründung und die bis dato erfolgreiche Entwicklung der AfD haben im jungkonservativen Lager kontroverse Reaktionen hervorgerufen. Was die JF anbetrifft, war es nicht weiter verwunderlich, dass sie sich als publizistische Plattform für die Anliegen der AfD präsentierte, hat sie doch seit Jahren auf eine solche politische Konstellation hingearbeitet und programmatische Vorarbeit geleistet. Wenn sich die JF 2011 in ihrem „Leitbild“ als national, freiheitlich, konservativ und christlich definiert (Junge Freiheit 2011, 6), so ist das der programmatische Rahmen (vgl. dazu Kellershohn 2013), in dem sich die AfD bewegt und bewegen wird. Die Nähe zwischen dem JF-Milieu und dem Kreis der AfD-Mitglieder und Sympathisanten ist unübersehbar.
Die Haltung des IfS und der Sezession zu dieser ‚Kumpanei’ war in ihrer Gespaltenheit zwischen „neuem Realismus“ (Weißmann 2014), politischem Existentialismus und metapolitischem Pluralismus nicht unbedingt vorherzusehen. Selbst Weißmann notierte noch 2009 in seinem „Konservativen Katechismus“, dass man sich als bekennender ‚Rechter’ vor „jeder Ablenkung ins ‚Liberalkonservative’, ‚Freiheitlich-Konservative’, ‚Kulturkonservative’. ‚Wertkonservative’“ hüten müsse (Weißmann 2009a, 36). Die Feigheit der bürgerlichen Mitte hat er des Öfteren beklagt. Insofern ist er es, der sich umorientiert hat und nunmehr auf die „’populistischen’ Möglichkeiten“ (Weißmann 2000, 251) setzt (und Gleiches der intellektuellen Rechten empfiehlt), die die JF schon seit längerem verfolgt und jetzt in einer ‚freiheitlich-konservativen’ AfD gegeben sieht.
Es bedarf noch einer genaueren Analyse, inwieweit die Kontroversen, die nun eine Zuspitzung erfahren haben, schon in früheren Konflikten angelegt gewesen sind. Es ist zu vermuten, dass bereits die Ablösung Kubitscheks als Geschäftsführer des IfS (2008) im Zusammenhang mit den internen Diskussionen um die von ihm initiierte Konservativ-subversive Aktion (vgl. dazu Kellershohn 2010b) einen Konfliktpunkt gesetzt hat, der nachwirkt. Schon damals ging es um die Frage, ob eine Strategie der Provokation zum ‚Geschäftsbereich’ des Instituts gehöre. Wenn Kubitschek nun als verantwortlicher Redakteur der Sezession die Grundsatzfrage „für oder gegen die Sezession“ stellt, während Weißmann die AfD als „einzig denkbare Option“ unter den gegebenen Bedingungen bezeichnet und damit die Position der JF unterstützt, so sind dies zweifellos Ausschließlichkeitsformeln, die eine Trennung nahelegen. Möglich ist aber auch, dass die Grundlagen der Arbeitsteilung und Kooperation im jungkonservativen Lager, sowohl im IfS als auch zwischen IfS und JF neu verhandelt werden.
Quellen
Junge Freiheit 2011: Der Freiheit eine Gasse. 25 Jahre Junge Freiheit. Eine deutsche Zeitungsgeschichte, Berlin.
Kleine-Hartlage, Manfred 2013a: Metapolitische Unterweisung (III), in: Sezession 56, 42-44.
Kleine-Hartlage, Manfred 2013b: Rebellion gegen die Lüge, in: Sezession 57, 46-48.
Kubitschek, Götz 2007: Provokation, Schnellroda.
Kubitschek, Götz 2012: Die Ein-Mann-Kaserne oder Expressive Loslösung, in: Sezession 50, 10-13.
Kubitschek, Götz 2013: Wellenberg, Wellental, in: Sezession, Sonderheft „Alternativen für Deutschland“, Mai 2013, 1.
Kubitschek, Götz 2014: Der romantische Dünger, in: Sezession 59, 33-35.
Lichtmesz, Martin 2013a: Alternative für Deutschland – Mit Mimikry ins Establishment? In: Sezession im Netz v. 26. August 2013.
Lichtmesz, Martin 2013b: Schmerzhafte Schnitte und schmerzhafte Wahrheiten, in: Sezession im Netz v. 4. Oktober 2013
Lichtmesz, Martin 2013c: Ruhepuls am Abgrund, in: Sezession 57, 42-45.
Stein, Dieter 2013: „Bei aller Skepsis: Diesmal hoffe ich!“ In: Sezession, Sonderheft „Alternativen für Deutschland“, Mai 2013, 18-19.
Stein, Dieter 2014: Für eine neue Nation. Nachdenken über Deutschland, Berlin.
Weißmann, Karlheinz 2000: Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Zehn Thesen zur Zukunft einer konstitutionellen Rechten in Deutschland, in: Ders.: Alles, was recht(s) ist, Graz/Stuttgart, 249-252.
Weißmann, Karlheinz 2006: Unsere Zeit kommt. Im Gespräch mit Karlheinz Weißmann, Schnellroda.
Weißmann, Karlheinz 2009a: Der konservative Katechismus, in: Sezession 29, 34-36.
Weißmann, Karlheinz 2009b: „Ich versuche, argumentativ vorzugehen und die Fragen grundsätzlich anzugehen“, in: Sezession, Sonderheft „Gespräche“, Dez. 2009, 13-16.
Weißmann, Karlheinz 2013a: Geduld! – Lage und Möglichkeit der intellektuellen Rechten, in: Sezession 55, 10-13.
Weißmann, Karlheinz 2013b: Politik und Metapolitik, in: Sezession 57, 38-41.
Weißmann, Karlheinz 2014: Neuer Realismus, in: Sezession 59, 30-32.
Sekundärliteratur
Kellershohn, Helmut 2010a: Strategische Optionen des Jungkonservatismus, in: Wamper/Kellershohn/Dietzsch (Hg.) 2010, 13-30.
Kellershohn, Helmut 2010b: Provokationselite von rechts: Die Konservativ-subversive Aktion, in: Wamper/Kellershohn/Dietzsch (Hg.) 2010, 224-240.
Kellershohn, Helmut 2013: Der ‚wahre’ Konservatismus der Jungen Freiheit, in: Ders. (Hg.): Die ‚Deutsche Stimme’ der ‚Jungen Freiheit’, Münster: Unrast Verlag, 60-134.
Wamper, Regina/Kellershohn, Helmut/Dietzsch, Martin (Hg.) 2010: Rechte Diskurspiraterien. Strategien der Aneignung linker Codes, Symbole und Aktionsformen, Münster: Unrast Verlag.
Fußnoten
(1) Zum Folgenden vgl. Kellershohn 2010a, 13-30.
(2) In diesen Auseinandersetzungen ging es zum einen um die geschichtspolitische Bewertung des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus, speziell um die Rolle Stauffenbergs als „Landesverräter“ oder Vorbild; zum anderen um die „Aufnahme eines Deutsch-Asiaten in eine Burschenschaft“ (Stein, JF 41, 2013, 18). Steins Intervention verfolgte auch parteipolitische Ziele, warnte er doch davor, dass sich die DB mit ihrer bisherigen ‚starren’ Haltung in eine „rechts-reaktionäre Ecke“ manövriere, so dass ihr nur noch die „rechtsradikale NPD“ als „parlamentarischer Anknüpfungspunkt“ bliebe.
(3) Das Rezept beschreibt Weißmann wie folgt: „Aufbietung des ‚gemeinen Mannes’ über einen offensiv vorgetragenen Patriotismus, der ausdrücklich auch im Sinn einer sozialen Schutzpflicht verstanden wird, und scharfe Wendung gegen eine als korrupt betrachtete Ordnung, ohne die Verfassung in Frage zu stellen.“
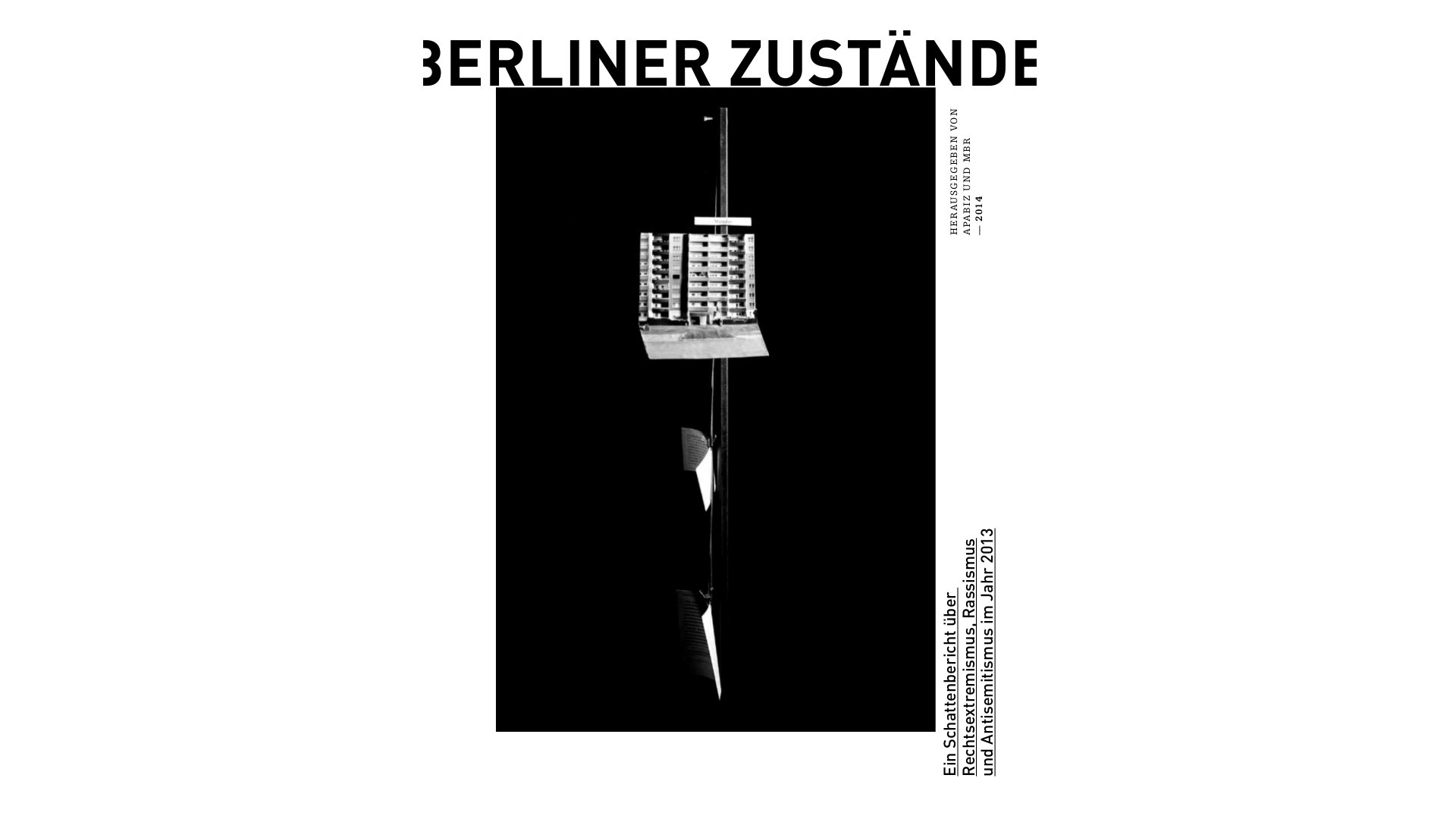

![Sebastian Schmidtke und Maria Fank (NPD bzw. RNF Berlin) [(c) apabiz]](http://www.blog.schattenbericht.de/files/2014/05/Berlin26Apr14_CS_1Mitte_124.jpg)
![Uwe Dreisch, Vorsitzender von Die Rechte Berlin (rechts), mit einem Aktivisten der "Weiße Wölfe Terrorcresw aus Thüringen" [(c) apabiz]](http://www.blog.schattenbericht.de/files/2014/05/Berlin26Apr14_CS_1Mitte_0101.jpg)
![Anti-Antifa-Aktivisten Christian B. (Bildmitte in Drohgebärde) und David G. (links im Bild ganz in Schwarz mit Basecap und Sonnenbrille) [(c) apabiz]](http://www.blog.schattenbericht.de/files/2014/05/Berlin26Apr14_CS_1Mitte_255.jpg)
![Maik Schneider (NPD Brandenburg) [(c) apabiz]](http://www.blog.schattenbericht.de/files/2014/05/Berlin26Apr14_CS_1Mitte_219.jpg)
![Neonazi-Aktivist aus Berlin [(c) apabiz]](http://www.blog.schattenbericht.de/files/2014/05/Berlin26Apr14_CS_1Mitte_105.jpg)

![Sebastian R. (Bildmitte mit Kinnbart) und weitere Aktivisten der neonazistischen Kameradschaftsstruktur "Weiße Wölfe Terrorcrew" (WWTC) [(c) apabiz]](http://www.blog.schattenbericht.de/files/2014/05/Berlin26Apr14_CS_1Mitte_076.jpg)
![Christoph Drewer (ehemaliger Aktivist des verbotenen "Nationalen Widerstands Dortmund" (NWDO) und heutiger Kandidat für Die Rechte [(c) apabiz]](http://www.blog.schattenbericht.de/files/2014/05/Berlin26Apr14_CS_1Mitte_156.jpg)
![Siegfried Borchert alias "SS-Siggi" (langjähriger Kader der Nazi-Hooligan-Gang "Borussen-Front" und heutiger Kreisvorsitzender von Die Rechte in Dortmund [(c) apabiz]](http://www.blog.schattenbericht.de/files/2014/05/Berlin26Apr14_CS_1Mitte_003.jpg)
![Michael Fischer aus Tannroda bei Weimar (Thüringen) beim Spontan-Aufmarsch in Adlershof [(c) apabiz]](http://www.blog.schattenbericht.de/files/2014/05/Berlin26Apr14_CS_2Adlershof_083.jpg)
![Aufmarsch mit Fahnen in Adlershof nach dem gescheiterten Versuch in Kreuzberg und Mitte [(c) apabiz]](http://www.blog.schattenbericht.de/files/2014/05/Berlin26Apr14_CS_2Adlershof_071.jpg)
![Fronttransparent des Spontan-Aufmarsches in Adlershof mit den NPDlern Ronny Zasowk (ganz links) und Sebastian Schmidtke (rechts daneben) [(c) apabiz]](http://www.blog.schattenbericht.de/files/2014/05/Berlin26Apr14_CS_2Adlershof_065.jpg)
![Der Brandenburger NPDler Maik Fischer (Bildmitte) und dahinter Dennis Giemsch (Vorsitzender Die Rechte NPD und früherer NWDO-Kader) [(c) apabiz]](http://www.blog.schattenbericht.de/files/2014/05/Berlin26Apr14_CS_2Adlershof_043.jpg)